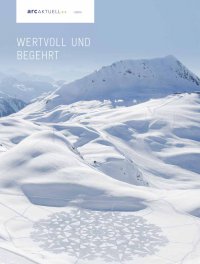
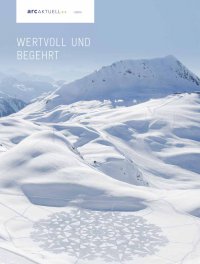
s c h w e r p u n k t 13 Amtliche Geoinformation ist wertvoll, daran gibt es keinen Zweifel. In einem Report, den das Joint Research Centre (JRC) 2006 veröffentlichte, wird geschätzt, dass eine Ge- samtinvestition in das INSPIRE-Projekt in einer Höhe von rund 230 Millionen Euro zu einem quantifizierbaren Nutzen von 1,2 bis 1,8 Milliarden Euro führen würde. Das wäre in der Tat ein beeindruckender Return on Investment; im Vergleich dazu muten die Renditeversprechen der insolventen Prokon in Höhe von 8 Prozent p.a. geradezu konservativ an. Informationen können im digitalen Zeitalter zu verschwin- dend geringen Kosten vervielfältigt werden. Das bedeutet: Je mehr eine Information genutzt wird, desto geringer ist der Anteil an den ursprünglichen Kosten für die Gewinnung der Information. Und während der Wert materieller Güter irgendwo in der Nähe ihrer Herstellungskosten vermutet werden darf, hängt der Wert von Informationen von ihrem Verwendungszweck ab. Für die Schatzkarte von Captain Flint in „Die Schatzinsel“ riskieren die Piraten ihr Leben, aber sonst interessiert sich kaum jemand für Karten irgend- welcher abgelegener Südseeinseln. Dies vorausgeschickt, stellt sich als Erstes die Frage, wer denn überhaupt für Geoinformation zahlen soll: der (amt liche) Anbieter oder der Nutzer? Naheliegend ist natürlich, dass der Nutzer zahlt. Man könnte dann auf die Idee kommen, den Preis nach Art und Umfang der Information festzulegen, so wie früher in der analogen Zeit. Das würde aber dazu führen, dass entweder Großnut- zer einen Spottpreis zahlen oder Geringnutzer wegen der zu hohen Kosten für sie abgeschreckt werden. Also versucht man, den Preis an Art und Umfang der Nutzung zu binden. Das ist aber nicht trivial, wenn für den Nutzer die Geoin- formation nur Teil eines komplexen Geschäftsmodells ist. Man muss es dann analysieren und mit anderen Konzepten vergleichen, und das in einem Umfeld, in dem Geschäfts- modelle ständig angepasst, verändert und verfeinert wer- den. Man mag sich nicht ausmalen, was passiert, wenn der- artig schwierige Preisfindungen mit 16 Bundesländern plus Bundesverwaltung unter Konsenszwang geschehen sollen. Die zweite Möglichkeit, bei der der Anbieter zahlt (Open Data), kann politisch oder wirtschaftlich begründet sein. Die politische Begründung heißt Open Government, mehr Transparenz von Politik und Verwaltungshandeln für den Bürger. Die wirtschaftliche Begründung liegt in der Annah- me, dass mit kostenlosen Geodaten die IT-Wirtschaft stimu- liert wird. Beide Begründungen sind nicht unumstritten und noch weit von einem politischen Konsens entfernt. In jedem Fall bleiben bei Open Data die Kosten beim Datenanbieter, und er muss sich auch entscheiden, welcher Kostenaufwand überhaupt getrieben werden soll in Hinsicht auf Datenqua- lität und Aktualität. Und dann muss erhöhte Transparenz oder Wirtschaftsförderung gegen andere politische Vor haben, beispielsweise die Zahlung von Mütterrenten, ab- gewogen werden. Auch dies keine leichte Aufgabe. Peter Ladstätter Esri Deutschland GmbH Kranzberg ++ Wert und Preis amtlicher Geoinformation